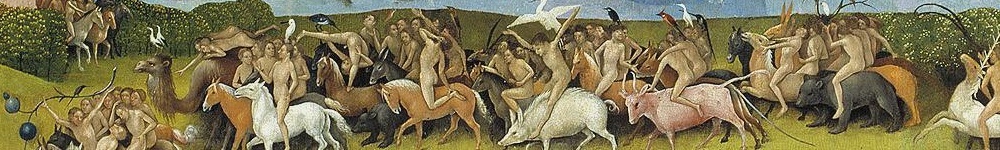 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das C17H19O5N des Volkes IIDaß die Religion "Opium des Volkes " ist, erscheint mir also als die zugleich schärfste und die für Marx' zeitgenössische Philosophie annehmbarste Kampfansage an alle ideologischen Phänomene, die zugleich schärfste und annehmbarste "Forderung, einen Zustand aufzugeben, der der Illusion bedarf". Diese Kritik dient der Verdeutlichung der eigenen theoretischen und praktischen Parteinahme und verändert sich, mildert sich als Angriff und verschärft sich als Erklärung, wo sie im Konzept welthistorischer Erörterung wieder aufgenommen wird.In den "Ökonomisch-philosophischen Manuskripten" handelt Marx die Entfremdung durch das Bestehen des Privateigentums ab, als eine der Bedingungen, die die Vorstellung einer "Schöpfung" zu einer "sehr schwer aus dem Volksbewußtsein zu verdrängenden Vorstellung" macht:"Ein Mensch, der von der Gnade eines anderen lebt, betrachtet sich als ein abhängiges Wesen", frage nicht nach seinem wirklichen Gewordensein, sondern nach der ursprünglichen Abhängigkeit. So erschienen Marx die Religion, der Atheismus der Wissenschaft und der Kommunismus gleichermaßen als sich ablösende Vermittlungen des Selbstbewußtseins des Menschen. Die Religion erfüllte diese Funktion nur unter Einschluß des "Geständnisses von derUnwesentlichkeit der Natur und des Menschen", währendder Atheismus diese Unwesentlichkeit durch die "Negation des Gottes" leugne unddurch diese Negation das "Dasein des Menschen" setze. Der Kommunismus, dem "die Sinne... unmittelbar in ihrer Praxis Theoretiker geworden" sind, "beginnt von dem theoretischen und praktisch sinnlichen Bewußtsein des Menschen und der Natur als des Wesens". Der Kommunismus (hier als theoretische und Denkbewegung für "die Gestalt der der menschlichen Gesellschaft" verstanden) steht wiederum sowohl außerhalb der Religion als auch der Wissenschaft; er muß dort stehen, weil ihm die allgemeinen Sinne den spezialisierten Theoretiker ersetzen, nunmehr erstzen können; der "Sinn des Habens" ist entschärfbar geworden. Religionskritisch in dem seiner Weltanschauung eigen Sinn, indem er aus den irdischen Widersprüchen die Entstehung ihrer verhimmelten Formen ableitete, war erst Marx' Darstellung eines Phänomens, in der und in dem kein Gran Religiösität enthalten ist: die Kritik des Warenfetischismus. Indem er die analytische Arbeit an die modernste statt an die naivste Form einer Verhimmelung verwandte, praktizierte er einmal mehr das Prinzip, daß "die Anatomie des Menschen... ein Schlüssel zur Anatomie des Affen" sei ("Einleitung zu den 'Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie'"), konnte er des theistischen wie des atheistischen Vorurteils entbehren. Die "Nebelregion der religiösen Welt" war ihm nur Analogie, Rückerinnerung, um zur Zerstörung der "mystischen Nebelschleier" vor der Warenwelt vorgehen zu können. "Das Geheimnisvolle der Warenform besteht also einfach darin, daß sie den Menschen die gesellschaftlichen Charaktere ihrer eigenen Arbeit als gegenstädliche Charaktere der Arbeitsprodukte selbst, als gesellschaftliche Natureigenschaften dieser Dinge zurückspiegelt, daher auch das gesellschaftliche Verhältnis der Produzernten zur Gesamtarbeit als ein außer ihnen existierendes gesellschaftliches Verhältnis von Gegenständen. Durch dieses Quidproquo werden die Arbeitsprodukte Waren, sinnlich übersinnliche oder gesellschaftliche Dinge... Es ist nur das bestimmte gesellschaftliche Verhältnis der Menschen selbst, welches hier für sie die phantasmagorische Form eines Verhältnisses von Dingen annimmt."So entsteht aus nüchterner Arbeit, im durchforschtesten und beherrschtesten Bereich menschlicher Tätigkeit, noch und gerade in der von der philosophischen Aufklärung vorbereiteten, in ihren wesentlichen Entscheidungen nicht religiösen und unmoralischen Gesellschaft ein quasireligiöses Phänomen. Ein Ding, die Ware, kann sich als Gott der warenproduzierenden Gesellschaft setzen, und mit diesem fortgeschrittensten Gott sind alle bisherigen erklärt: als Produkt des menschlichen Kopfes und als Produzenten geistiger Vorstellungen und materieller Handlungen.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||