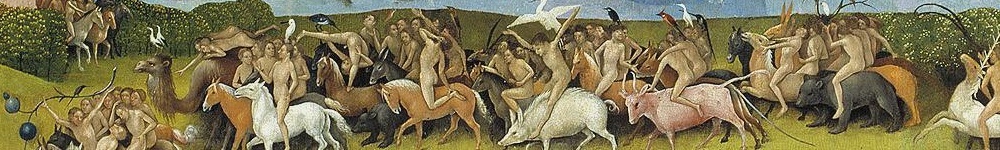 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
"Der Gott, der ist, ist der Gott der Proletarier."Mit dem frommen Wunsch, die herrschende Klasse möge wohltätig sein, mit dem Versprechen der Ausgleichung aller Infamien im Himmel und der Erklärung, alle Niederträchtigkeitender Ausbeuter seien Bestrafungen von Sünden oder Prüfungen, qualifizierten sich (so Karl Marx 1847) die "sozialen Prinzipien des Christentums" als "duckmäuserisch". Sie hätten "jetzt achtzehnhundert Jahre Zeit gehabt, sich zu entwickeln, und bedürfen keiner ferneren Entwicklung durch preußische Konsistorialräte." 1Diese Betrachtung läßt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig - nur war sie eben nicht (wie R. Steigerwald 1973 annahm) "eine historische Kritik" des Christentums, die Aufdeckung der Klassenfunktion der Religion, "daß sie durch ideologische Mittel das den herrschenden Klassen erleichtern soll, was durch den Einsatz der nackten Gewalt allein nicht erreicht werden kann." 2 Marx wandte sich mit allem stilistisch-denunziatorischem Vermögen gegen den den Versuch des "preußischen Konsistorialrats", die von diesem beschworenen "sozialen Prinzipien des Christentums" gegen die kommunistische Propaganda zu verwenden. Eher wie Christus ("Der Mensch lebt nicht vom Brot allein..." Matthäus 4,4) wollte Marx festschreiben, daß "das Proletariat, das sich nicht als Kanaille behandeln lassen will, ... seinen Mut, sein Selbsgefühl, seinen Stolz und seinen Unabhängigkeitssinn noch viel nötiger als sein Brot" habe. Marxistische historische Kritik des Christentums konnte und kann diese Religion sowenig als "falsches Bewußtsein" und "ideologisches Unterdrückungswerkzeug" abtun, wie es mit ihr fertig würde, "indem man sie einfach für von Betrügern zusamemngestoppelten Unsinn erklärt". Wie Friedrich Engels hervorhob, gilt es die Frage zu lösen, wie es gekommen sei, "daß die Volksmassen des römischen Reiches diesen noch dazu von Sklaven gepredigten Unsinn allen anderen Religionen vorzogen, so daß endlcih der ehrgeizige Konstantin in der Annahme dieser Unsinsnreligion das beste Mittel sah, sich zum Alleinherrscher der römischen Welt empor zu schwingen". 3 Auch als ideologisches Unterdrückungswerkzeug muß die Religion, die darauf sogar am meisten angewiesene ideologische Form, "die Massen ergreifen", um materielle Gewalt ausüben zu können; niemand läßt sich aber von Ideen ergreifen, die ihm erkennbar zum Nachteil gereichen... Der ganz und gar "irdische" Ausgangspunkt der berühmtesten Arbeit von Engels zu diesem Thema ("Zur Geschichte des Urchristentums", 1894) ist eine Antikritik zur Kritik des "irdischen Trostes", der Forderung des Sozialismus. Ein Professor anton Menger führte gegen dessen Möglichkeit an, daß auch "auf den Sturz des weströmsichen Reichs nicht der Sozialismus gefolgt sei": trotz der Zentralisierung des Grundbesitzes und er Versklavung der arbeitenden Klasse. Dem hielt Engels entgegen, "daß dieser 'Sozialismus', soweit er damals möglich war, in der Tat bestand und auch zur Herrschaft gelangte - im Christentum". 4 Alle "sozialen Prinzipien des Christentums", die Karl Marx in ihrer konsistorialrätlichen Fassung und in der Konfrontation mit den sozialen Prinzipien einer sozialen Klasse leichthin abtuen konnte, erschienen in ihrer undogmatisierten und kollektiven Fassung und im Beginn der Entwicklugn moderner sozialer Klassen also als höchst revolutionär, zumindest "kulturrevolutionär". Die juristische oder biologistische Sanktion der Sklaverei und der Sklavenhalterstaaten, aber auch die politische und ökonomische Benachteiligung der armen Freien des römischen Reiches wurden so radikal wie möglich abgetan: die Prediger der neuen Religion wandten sich gerade an diese "Mitgenossen in der Trübsal", die als vergänglich und als kurz vor dem Vergehen verstanden wurde; das "Reich Gottes" war als "seine Gerechtigkeit" unwirklich und begreifbar; man konnte nicht zwei Herren, "nicht Gott dienen und dem Mammon"; eher ließe sich Tau durch ein Nadelöhr fädeln, passe ein Kamel durch die kleinste Pforte der Jerusalemer Mauer, "denn daß ein reicher ins Reich Gottes komme". Daher erscheint der bloß "religiöse Ausweg", der Verweis auf eine Gerechtigkeit und ein göttliches Gericht nach dem Tode des Einzelnen oder nach dem Untergang der Welt, freilich nur dem weig fürchterlich, antirevolutionär und eine Apologie des Diesseits, der an die Fortexistenz der Seele nach dem Tode des Leibes nicht glaubte. Der im Namen Gottes und seines Sohnes verheißene Zustand war zudem nicht so eindeutig und unwidersprocehn "jenseitig" und "religiös", wie ihn später institutionalisierte Exegese und atheistische Kritik erscheinen ließen. Daß Christi Reich "nicht von dieser Welt" sei, hielt Ernst Bloch für eine spätere Einfügung in die "Frohe Botschaft": "sie sollte den Christen vor einem römischen Gericht von Nutzen sein. Jesus selbst hat nicht versucht, sich vor Pilatus mit feigem Jenseits-Pathos ein Alibi zu geben." 5 Wo Christen in Unterdrückung und Armut versuchten, diese Botschaft im Kontext ihrer Lebensbedingungen und Erfahrungen zu verstehen, wurde sie noch nach 1900 Jahren Antipropaganda revolutionär interpretiert: "Ich glaube, wenn die Menschen damals das Wort 'Reich' hörten, dann dachten sie nur an ein Sklavenreich wie das ihre, und Jesus sagte ihnen, sein Reich sei ein Reich der Liebe." Und: "Das Reich Gottes ist ein Reich der Freiheit, und alle andere Reiche sind Reiche der Unterdrückung, darum muß er einen Unterschied machenund sagen, sein Reich habe nichts mit diesem System zu tun." 6 Ebenso findet sich in die prophetischen Beweise auch diesseitige Verheißung eingeschlossen: "Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen; daß man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird." (Jes. 65,17) Nicht der römische Staat, nicht die bestehenden mächtigen Tempel der Opfertier-Händler und Geldwechsler und nicht die Zirkel der Schriftgelehrten sind den frühen Christe geheiligte und heilende Instanzen gewesen, sondern ihre Versammlungen von Fischern, verachteten Zöllnern, reuigen Ehebrecherinnen und gehiligten Besessenen: "Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch:" (Luk. 17,21) 2 Steigerwald, R.: Marxismus - Religion - Gegenwart. Berlin 1973, S. 85. 3 Engels, F.: Bruno Bauer und das Urchristentum. In : Werke, Bd. 19, a.a.O., S. 297 f. 4 Engels, F.: Zur Geschichte des Urchristentums. In: Werke, Bd. 22, Berlin 1977, S. 449. 5 Bloch, E.: Freiheit und Ordnung, Abriß der Sozialutopien. Leipzig 1985, S. 40/41. 6 Cardenal, E.: Das Evangelium der Bauern von Solentiname. Wuppertal 1976.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||