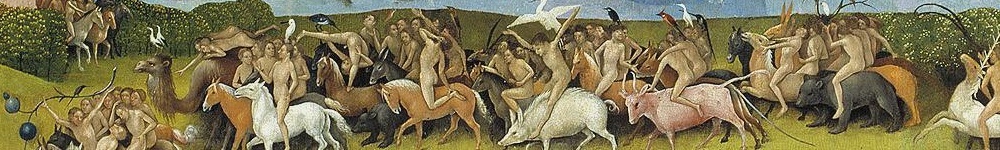 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
"... hat in der Geschichte eine Rolle gespielt ..." IIIn Ansehung aller bisherigen Geschichte als eine Geschichte von Klassenkämpfen beschwört eine kurze Parade historischer Subjekte Unruhe: "Freier und Sklave, Patrizier und Plebejer, Baron und Leibeigener, Zunftbürger und Gesell" erinnern etwa Spartakus, Catilinia, den Großen Bauernkrieg und die Handwerkeraufstände - als Hausnummern ohne Zweifel ideelles Gemeingut. Bereits diese Aufzählung verweist auf die anhaltende Unversöhnlichkeit der Klasseninteressen, die präzise Behauptung eines "ununterbrochenen, bald offenen, bald versteckten Kampfes" charakterisiert den Zweifel daran als eine Form des Versteckens. Die Gliederung der Gesellschaft im alten Rom (Patrizier, Ritter, Plebejer, Sklaven) und im Mittelalter (Feudalherren, Vasallen, Zunftbürger, Gesellen, Leibeigene) versetzt den Leser instand, darüber zu urteilen, daß sich die moderne bürgerliche Gesellschaft "mehr und mehr" (!) in "zwei große feindliche Lager" (!) spaltet, "in zwei große, einander direkt gegenüberstehend Klassen: Bourgeoisie und Proletariat". Die Grundklassen werden als ein Prozeß vorgestellt.I Nicht die Willkür oder die gewollte Objektivität des Systematikers, sondern der geschichtliche Prozeß trägt in der Darstellung des "Manifests" die Elemente der Bourgeoisie zusammen: die EntdeckungAmerikas, die Kolonisierung der nichteuropäischen Kontinente, die Entwicklung des Welthandels, der großen Industrie. Nicht die Verwendung besonderer Kategorien, sondern die besondere Verwendung der allgemeinen Sprache definiert: augenscheinlich könnten sich die Fakten auch so ordnen lassen, erfahrungsgemäß vielleicht, dem gesunden Menschenverstand nach... So gewinnt die Bourgeoisie Kontur, nicht nur als nichtrs Fremdes, auch als nicht unbedingt Feindliches: "Jede dieser Entwicklungsstufen der Bourgeoisie war begleitet von einem entsprechenden politischen Fortschritt." Nicht nur die Abgrenzung und die Entgegensetzung, vielmehr die Besetzung des bürgerlichen Erbes ist intendiert, wenn Marx und Engels ausführen, die Bourgeoisie habe "in der Geschichte eine höchst revolutionäre Rolle gespielt". Für Jürgen Kuczynski ist diese Passage ein Beispiel "nicht wissenschaftlicher", mehr künstlerischer Aneignung des Stoffes: er verweist insbesondere auf den Mangel an Idylle in den "feudalen, patriarchalischen, idyllischen Verhältnissen", die von der kapitalisitischen Entwicklung zerstört würden, aber auch auf die bürgerliche Inkonsequenz beim Abreißen der "rührend-sentimentalen Schleier". Wissenschaftliche, adäquate Abbildung verwische jedoch den historischen Unterschied, sowohl zwischen feudaler und bürgerlicher Gesellschaft als auch zwischen "feudalem" und wissenschaftlichen Sozialismus. Der Überschwang, das Übermaß erst schaffe den maßvollen Blick auf die Veränderungen. Dieser Interpretation ist zuzustimmen, 1 sie ist sogar noch zu ergänzen. Gegen die Bourgeoisie stehen: "fromme Schwärmerei", "Heiligenschein", "brutale Kraftäußerung" und "träge Bärenhäuterei", "alles Ständische und Stehende", "uralte Industrie", "chinesische Mauern", "hartnäckigster Fremdenhaß", "Idiotismus des Landlebens"... Ist die Bourgeoisie, an die Moral rührend, noch mit Distanz schaffenden Wendungen beschrieben ("aht die persönliche Würde in den Tauschwert aufgelöst"), so ist die Beschreibung ihres wirtschaftlichen Wirkens unverkennbar positiv gehalten. Sie gestaltet "die Produktion aller Länder kosmopolitisch", schafft "neue Industrien", überwindet die "alte lokale und nationale Selbstgenügsamkeit und Abgeschlossenheit", bildet "eine Weltliteratur", setzt auf "wohlfeile Preise"... Der Apologie entgegen wirken die Tätigkeitsworte: "zerstören", "zerreißen", "ertränken", "entweihen", "jagen", "einnisten", "unterwerfen"... Aus diesem Material, eindeutig in der Tendenz, werden widerspruchsvolle Sätze gebildet: "Die wohlfeilen Preis ihre Waren sind die schwere Artillerie, mit der sie alle chinesischen Mauern in den Grund schießt..." Manche der Bestimmungen widersprechen späterer, heutiger Erfahrung kraß: die "buntscheckigen Feudalbande" können das Band des nackten Interesses zwischen japanischen Unternehmern und japanischen Unternommenen höchst effektvoll drapieren, festigen, enger knüpfen. Die "fromme Scheu" etwa vor der Tätigkeit des Arztes sichert dem zu jener Zeit ganz undenkbaren Zweiten Deutschen Fernsehen selbst in der seriellen Fiktion höchste Einschaltquoten, manipulierenden Effekt... Manhe de Bestimmungen beschimpften und beschimpfen den potentiellen Leser, etwa in "barbarischen und halbbarbarischen Ländern", etwa den im "Idiotismus des Landlebens" beheimateten. Dem deutschen Kleinstaatsbürger der Entstehungszeit des "Manifests" wird mit dem Nächstliegenden gedroht: "eine Nation, eine Regierung..." Dem wissenschatlichs-sprachlichen Resümee, "Die Bourgeoisie hat in ihrer kaum hundertjährigen Klassenherrschaft massenhaftere und kolossalere Produktionskräfte geschaffen als alle vergangenen Generationen zusammen", stehen eben diese Verluste, Widersprüche und Beleidigungen gegenüber. Der Augenblick des Triumphes der Bourgeoisie ist der ihres Sturzes: "Unter unseren Augen geht eine ähnliche Bewegung vor..." Die historische Definition der Bourgeoisie definierte den Ursprung, den Ansatz der proletarischen Revolution. Die Sprache, in der das Proletariat vorgestellt wird, ist nüchterner: seine bisherige welthistorische Tat ist seine Konstituierung, gegen die betriebliche und lokale Konkurrenz. Auch stilistisch wird so angedeutet, daß "die Lebnensbedingugn der alten Gesellschaft (...) schon (...) inden Lebensbedingungen des Proletariats" vernichtet sind. Seine Tätigkeiten sind: "leben", "Arbeit finden", "verlieren", "kämpfen"... Und wieder ist nicht die Befestigung dieser sich ergebenden Definition das Ziel. "Bourgeois und Proletarier" sind kenntlich geworden, wenn sich der neue Problemkreis öffnet: Der Untergang der Bourgeoisie und der Sieg des Proletariats seien unvermeidlich.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||