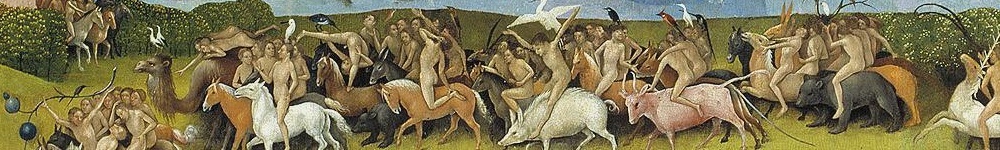 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Exempel Heinrich HeineSeit Sokrates haben die Philosophen vergänglich auf das "unvergängliche Bedürfnis des Menschengeistes", das "Bedürfnis der Überwindung aller Widersprüche" reagiert: mit der Bildung philosophischer Systeme. Althergebrachte Forderung an ein System aber war und ist, "mit irgendeiner Art von absoluter Wahrheit abzuschließen". Diese Art, die bis dahin vorherrschende, so beschreibt Engels, führte mit der Philosophie Hegels an das Ende der (so aufgefaßten) Philosophie. Es ist ein Ende in Ohnmacht: die Notwendigkeit des Systems, "der ganze dogmatische Inhalt" wird "für die absolute Wahrheit erklärt, im Widerspruch mit seiner dialektischen, alles Dogmatische auflösenden Methode; damit wird die revolutionäre Seite erstickt unter der überwuchernden konservativen. Und was von der philosophischen Erkenntnis, gilt auch von der geschichtlichen Praxis." 1 Zugleich aber ist es ein Ende der Bestätigung: "weil er uns, wenn auch unbewußt, den Weg zeigt aus diesem Labyrinth der Systeme zur wirklichen posiitiven Erkenntnis der Welt." Der Philosophie ein Ende auf dem geschaffenen Niveau zu bereiten, hieß nicht, "daß man sie kurzerhand ignorierte". Die Hegelsche Philsophie mußte "in ihrem eigenen Sinn 'aufgehoben' werden, d.h. in dem Sinn, daß ihre Form kritisch vernichtet, der durch sie gewonnene Inhalt aber gerettet wurde". 2 Dies, neben der von Engels erw ähnten, revolutionären Brisanz "sah bereits 1833 wenigstens ein Mann, und der hieß allerdings Heinrich Heine". 3 "Sie, und nicht wir" hatte Klopstock 1790 eine Elegie über die klassische Revolution des Bürgertums betitelt. Die allgemeinen Hoffnungen in die französische Revolution und die Enttäuschungen demokratischer Intellektueller über die weitere Stagnation Deutschlands verband Hölderlin 1798 zur berühmten Klage: "Es ist ein hartes Wort und dennoch sag ich's, weil es Wahrheit ist: ich kann kein Volk mir denken, das zerrißner wäre, wie die Deutschen. Handwerker siehst du, aber keine Menschen, Denker, aber keine Menschen, Priester, aber keine Menschen, Herrn und Knechte, Junge und gesetzte Leute, aber keine Menschen - ist das nicht, wie ein Schlachtfeld, wo Hände und Arme und alle Glieder zerstückelt und untereinanderliegen, indessen das vergoßne Lebensblut im Sande zerrint?" 4 Heine, in dieser Intention dem mit den Befreiungskriegen einsetzenden Nationalismus widerstehend, zeichente als Erster das dialektische Bild, das seit dieser Zeit entstand. 1831 schrieb er: "...und man sollte glauben: die Franzose, denen soviel wirkliche Geschäfte oblagen, wobei sie durchaus wach bleiben mußten, hätten uns Deutsche ersucht, unterdessen für sie zu schlafen und zu träumen, und unsere deutsche Philosophie sei nichts anderes als der Traum der französischen Revolution." 5 Liestman sich in sein Buch "Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland" ein, könnte man für Bescheidenheit des Laien, des populärwissenschaftlichen Autors halten, wenn er "großen deutschen Philosophen" vornehmes Achselzuckenüber das Vorgebrachte zugesteht. Für das Buch spreche: "Was helfen dem Volke die verschlossenen Kornkammern, wozu es keinen Schlüssel hat? Das Volk hungert nach Wissen und dankt mir für das Stückchen Geistesbrot, das ich ehrlich mit ihm teile." 6 Allerdings bemerkt Heine angelegentlich des "schwerfälligen, steifleinenen Stils" Kants, dieser habe nbei seinen Nachäffern den Aberglauben erzeugt, daß man kein Philosoph sei, wenn man gut schriebe". Wo könnte der Hörer und Schüler Hegels, dem der Meister persönlich anvertraut habe, sein Satz von der Vernünftigkeit alles Seienden meine Revolution, 1834 also "große deutsche Philosophen" vermutet haben? 7 4 Hölderlin, F.: Hyperion. Berlin, S. 175. 5 Heine, H.: Einleitung zu "Kahldorf über den Adel". In: Werke und Briefe in zehn Bänden, Bd. 4. Berlin und Weimar 1980, S. 275 f. 6 Heine, H.: Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland. In: Werke und Briefe..., Bd. 7. a.a.O., S. 306 f. 7 Vgl.: ebenda, S. 262. Heine, H.: Briefe über Deutschland. In: Werke und Briefe..., Bd. 7. a.a.O., S. 306 f.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||