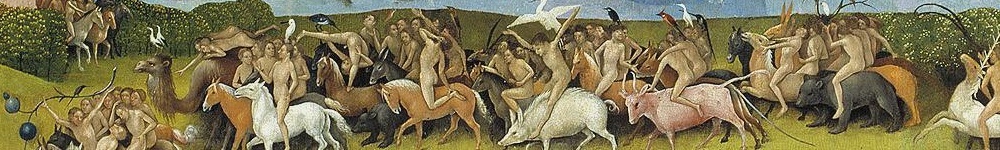 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Melodie des Kapitals"Das Kapital" versahen Marx selbst, Engels und Lenin, viele namhafte Führer und Theoretiker der internationalen Arbeiterbewegung und erst recht die Propagandisten des Marxismus-Leninismus mit den ehrendsten und schmückendsten Beinamen: Marx' ökonomisches, Marx' wissenschaftliches Hauptwerk, das für die Arbeiter wichtigste Buch imMarxismus usw., sogar "die Bibel der Arbeiterklasse", wie Engels zeitgenössische Stimmern zitierte. Schon ein Teil seiner Geschichte, seinVerlag in der DDR ist beeindruckend: seit 1945 stellte Dietz fast 900.000 Exemplare des ersten Bandes her, alle drei Bände erreichten eine Auflagenhöhe von über zwei Millionen. Unbedingt zuzustimmen ist Professor Dr. sc. oec. Wolfgang Jahn, der zur Einführung in das Studium des "Kapital" schreibt: "Lehrbücher und Einführungen können seinStudium erleichtern und ergänzen, jedoch auf keinen Fall ersetzen. An der Quelle ist das Wasser rein und kar, dort kann man bis auf den Grund blicken." 1 Gegen diese Wertungen und Fakten spricht nicht, daß eben jenes Buch als Ganzes (alle seine Bände, von der ersten bis zur letzten Zeile) wohl kaum gelesen worden ist und gelesen wird. Der Autor dieser Arbeit rühmt sich der Ausnahme nicht; gelegentliche, also nicht repräsentative Nachfragen bei Lehrern des Marxismus-Leninismus, und zwar aller seiner Bestandteile, vermehrten sein unreines Gewissen kaum. Einer der berühmtesten "Kapital"-Leser, denn er rühmte sich derLektüre selbst, war Bertolt Brecht. 1926 und in den folgenden Jahren teilte er mit, er habe "acht Schuh tief im 'Kapital'" gesteckt, durch dieses Studium habe er gelernt, seine eigenen frühen Stücke zu verstehen. 2 Auf dem wissenschaftlichen Brecht-Dialog 1983 versuchte Thomas Marxhausen eine Antwort, wie tief "acht Schuh" gewesen sei. Daß in der "Dreigroschenoper" die ursprüngliche Akkumulation des Kapitals thematisiert sei, daß in "Die Heilige Johanna der Schlachthöfe" der Krisenzyklus dramaturgische Bedeutung gewinne, sind ganz unstrittige Darlegungen. Wenn MArxhausen allerdings feststellt, "Bei aller Tiefe seiner Einsichten in die Struktur des kapitalismus ist nicht zu übersehen, daß sich Brecht nach wie vor inder Zirkulationssphäre - dem Umkreis des Handels- und Bank-Kapitals bewegt", 3 wird (wie an anderer Stelle auch) eine sehr verschiedene Beweislast erkennbar. Weder eine künstlerische Darstellung der ursprünglichen Akkumulation noch die künstlerische Instrumentalisierung des Krisenzyklus setzen ein intensives "Kapital"-Studium voraus, während der erste tiefere Blick ins "Kapital" ein Blick gerade auf die Produktion des Kapitals ist. So scheint mir Eislers Meinung, sehe man Marx an "wo er Weltgeschichte gemacht hat, im 'Kapital'", wede man keinen Bezug zu Brechts Marxismus-Rezeption und -Entwicklung finden, weiter unwidersprochen. Als Eislers Gesprächspartner nach der Auskunft über Brechts Lesegewohnheiten (aus Hegel ließ er sich Auszüge machen oder referieren, seinen literarischen Gegner Thomas Mann las er nie) fragt, das "Kapital" habe Brecht doch aber wohl gelesen, ist die Antwort: "Zumindest den ersten Band." "Mehr nicht?" "Das war auch nicht nötig für ihn. Das genügte für Brecht." 4 Gleichwohl können "acht Schuh tief" die zumVerständnis ausreichende Tiefe sein. Eislers "nötig für...", "genügte für..." benennt das wichtigste Moment der Marxschen Wirkuns-Intention beimAufbau des "Kapital". Der erste Band untermauert immerhin die Grundauffassung der materialisitischen Gesellschaftstheorie, realisiert immerhin den methodischen Anspruch der Thesen über Feuerbach, aus der irdischen praktischen Erscheinung die "verhimemlten" Formen abzuleiten, und schafft immerhin das wesentlichste Instrumentarium politökonomischer Analyse. Der erste Band ist in einem populärwissenschaftliche Darstellung, Lehrbuch und Forschungsbericht: didaktische Aufbereitung ist die auffälligste Tendenz zwischen Erstauflage und endgültiger Gestalt. Im wesentlich selben Text änderte Marx die Gliederung so, daß sich der Leser rasch erschließen kann, was für ihn zu wissen nötig ist. Da möchte einLeser zum Beispiel wissen, wie das mit "Kauf und Verkauf der Arbeitskraft" ist, und er findet einen solchen Absatz als 4.3. Der Absatz ist so eingeleitet, daß das Zurückblättern nicht unbedingt nötig ist: "Die Wertveränderung des Geldes, das sich in Kapital verwandeln soll, kann nicht an diesem Geld selbst vorgehn, denn als Kaufmittel und als Zahlungsmittel realisiert es nur den Preis der Ware, die es kauft ode zahlt, während es, in seiner eigenen Form verharrend, zum Petrefakt gleichbleibender Wertgröße erstarrt." 5 Dieser Satz gibt Auskunft darüber,
Auch die Darstellung, daß nicht bloßer Wiederverkauf eine Wertzunahme der Ware erbringen kann, ist von dieser Art. Die ökonomische Alltagserfahrung konkretisiert die Termini, wenn Marx übersetzt: "Gebrauchswert als solcher, d.h. (...) Verbrauch", "innerhalb der Zirkulationssphäre, auf dem Markt". Was für Marx und den an der Wissenschaftlichkeit interessierten Leser die Entdeckung der Doppelnatur des Warenwertes, der Funktion des Geldes usw. zur Voraussetzung hatte, scheint in dieser Darstellung eine Folge des logischen Argumentierens aus dem gesunden Menschenverstand heraus: um zu Kapital zu kommen, muß man "eine Ware (...) entdecken, deren Gebrauchswert selbst die eigentliche Beschaffnheit besäße, Quelle von Wert zu sein". Die so in Marx Fußstapfen entdeckte "Spezifik der Ware Arbeitskraft" ist zugleich in ihrer einfach verständlichen AEinzigartigkeit wie in ihrer ungeheuren Bedeutung für die gesamte Ökonomie verstanden. Mit dieser Einführung zu ihr hin wird die polit-ökonomische Sicht auf die naiv erfahrene Ökonomie und Ökonomik trainiert, ohne daß der "Volkstümlichkeit", der Selbstzufriedenheit und damit der theoretischen Arroganz Raum gegeben wir - einer Gefahr der Populärwissenschaft a la "Paul will also sen Taschenmesser verkaufen". 2 Brecht, B.: Über Kunst und Politik. Leipzig 1977, S. 33. 3 Brecht 83. Brecht und Marxismus. Berlin 1983, S. 58. 4 Eisler, H.: Gespräche mit Hans Bunge. Leipzig 1975, S. 137. 5 Marx, K.: Das Kapital. Kritikder politischen Ökonomie. Erster Band. In MEW, Bd. 23, Berlin 1977, S. 181.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||