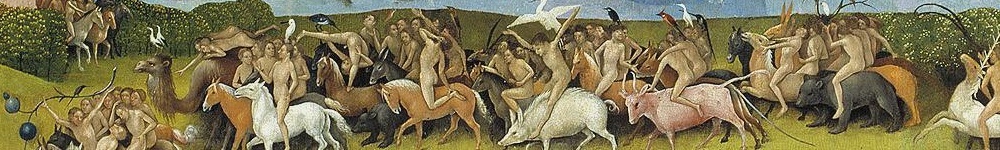 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
"Die Dialektik lernten wie nicht grad bei Hegel..."Einer der griffigsten Marxschen Sätze, auf den denn auch gern zurück gegriffen wird, gilt es, Marx oder ein revolutionäres Jubiläum mit Spruchbändern zu würdigen, scheint: die Idee wird zur materiellen Gewalt, wenn sie die Massen ergreift. Im Wortlaut und im Zusammenhang sollte dieser Satz ein wenig Komplizierteres ausdrücken, doch in etwa meinte er das Gemeinte schon, etwas Selbstverständliches. So trafen sich die Petrograder Arbeiter ja tatsächlich nicht zufällig an einem Mittwoch-Abend vor dem Winterpalais, mit eben genug Zeit für eine Eroberung. Daß sie von der Idee einer sozialistischen Revolution für Frieden, Brot und Sowjet-Macht ergrifen waren und Lenins Idee eines bewaffneten Aufstands aufgegriffen hatte, versteht sich von selbst. Aber: was hatte gegriffen? Wieviele der Erstürmer hatten abgewogen, ob die Bolschewiki die Staatsmacht überhaupt behaupten konnten? Wieviele wußten wie Lenin, daß es "gestern zu früh, morgen zu spät" für ihre Machtergreifung gewesen war, sein würde? Was im Leninschen Denken, Schreiben und Sprechen wirkte wie? Darin besteht das Problem: das Selbstverständliche war und ist immer nur das Einzelnen, Gruppen oder massen Verständliche. Zeugnisse dafür sind selten. John Reed teilte ein Gerücht mit, daß in jenen Tagen, die die Welt erschütterten, in Umlauf war und auf das Erschöpfendste Auskunft gibt, wie (und wie gut) der Leninismus verstanden wurde: "Von den Intellektuellen waren nur Lenin und Trotzki für den Aufstand. Selbst die Militärfachleute lehnten ihn ab. Es wurde eine Abstimmung vorgenommen und der Aufstand verworfen. Da aber erhob sich mit wutverzerrten Zügen ein Arbeiter: 'Ich spreche für das Petrograder Proletariat', stieß er rauh hervor. 'Wir sind für den Aufstand, macht, was ihr wollt. Aber das eine sage ich euch: wenn ihr gestattet, daß die Sowjets auseinander gejagt werden, dann sind wir mit euch fertig.' Einige Soldaten schlossen sich dieser Erklärung an... Eine zweite Abstimmung wurde vorgenommen und - der Aufstand beschlossen:" 1 Und John Reed teilt mit, was an Leninismus "Der Mann mit dem Gewehr" verstanden hatte, als Protokollant einer Straßendiskussion. "Ich habe zwei Jahre lang in Schlüsselburg gesessen, als du noch Revolutionäre niederschossest und 'Gott erhalte den Zaren' sangest", führte ein Student endlich sein stärkstes Argument an. "Und ich bin ein Gegne der Bolschewiki, die unser Rußland und die Revolulution zugrunde richten. Wie erklärst du dir das?" Sein soldatischerKontrahent kratzte sich den Kopf und wiederholte ein weiteres Mal: "Das kann ich mir nicht erklären. Mir scheint die Sache ganz einfach; aber ich bin ja kein gebildeter Mann. Es gibt nur zwei Klassen, die Bourgeoisie und das Proletariat... Nur zwei Klassen, (...) und wer nicht auf der einen Seite ist, der ist auf der anderen." 2 Die Dialektik lernten die russischen Revolutionäre, wie Majakowski schrieb, nicht gerade bei Hegel, nicht einmal bei Lenin: "mit Kampfgeprassel / nbrach sie in den Vers." Die Marx-Bände seien geöffnet worden wie "daheim / die Fensterladen". 3 Was eine weitere Selbstverständnlichkeit scheint, im ersten Bedenken ein Problem der Philosophie-Vermittlung, der populärwissenschaftlichen Darstellung u.ä., ist eine Schicksalsfrage der marxistischen Philosophie - nämlich die Frage, Wirkung zu haben oder Wirkung zu verfehlen. In seiner kritik an Bucharins "Gemeinverständlichem Lehrbuch der marxistischen Soziologie" bemerkte Antonio Gramsci: "Das Gemeinverständliche Lehrbuch irrt, (indirekt) von der Voraussetzung auszugehen, daß sich dieser Ausarbeitung einer eigenständigen Philosophie die großen Systeme der traditionellen Philosophie entgegenstellen, d.h. die Konzeptionen der Welt der Intellektuellen und der Hochkultur. In Wirklichkeit sind diese Systeme den meisten Menschen unbekannt, und sie haben keine direkte Wirksamkeit für ihre Art zu denken und zu handeln." 4 Ohne die Kritik der der systematischen Philsopophie zu vernachlässigen, müsse der Marxismus von der Kritik des Alltagsverstandes ausgehen; Ziel des Marxismus, wie jeder Philosophie, sei und müsse sein, "Alltagsverstand eines Milieus zu werden", - kritisch die intellektuelle Tätigkeit herauszuarbeiten, die bei jedem bis zu einem gewissen Grade vorhanden ist, und deren Verhältnis zur körperlichen Arbeit in Richtung auf ein neues Gleichgewicht zu verändern." 5 3 Majakowski, W.: Mit aller Stimmkraft. In: Ausgewählte Werke, Bd. II. Berlin 1968, S. 421. 4 Gramsci, A.: zitiert nach: Kebir, S.: Alltag bei Gramsci. In: Weimarer Beiträge, Berlin und Weimar, Jg. 32 (1986), 3, S. 438. 5 Gramsci, A.: Zu Politik, Geschichte und Kultur. Leipzig 1980, S. 231.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||