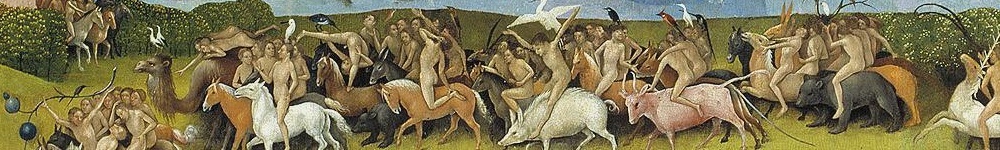 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Melodie des Kapitals IISo realisiert gerade Marx' wissenschaftliches Hauptwerk, aus der Sicht der Philosophen das Hauptwerk zur Dialektik, aus der Sicht des Logikers ein Meisterwerk logischen Denkens und Schreibens usw., die demokratische literarische Maxime des jungen Marx: "Wir treten dann nicht der Welt doktrinär mit einem neuen Prinzip entgegen: Hier ist die Wahrheit, hier knie nieder! (...) Wir sagen ihr nicht: Laß ab von deinen Kämpfen, sie sind dumme Zeug; wir wollen dir die wahre Parole des Kampfes zuschrein. Wir zeigen ihr nur, warum sie eigentlich kämpft..." 1 Die Wirkungsabsicht, der wissenschaftlichen oder künstlerischen oder moralischen... Wirkung übergeordnet und deren Vollendung, prägt auch die Definitionen des "Kapital". Das Wörterbuch der Ökonomie, an die Werktätigen, Propagandisten und Studenten adressiert, definiert uns den Preis: "objektive ökonomische Kategorie, Geldausdruck des Wertes einer Ware..." 2 Sofort tun sich die Fragen auf, was denn "objektiv" und "Ware" ist. Marx dagegen schreibt, kaum buchstaben-extensiver, aber so, daß alles Relevante auch ausgeliefert wird: "Der Preis der Ware ist also nur der Geldname des in ihr vergegenständlichten Quantum gesellschaftlicher Arbeit." 3 "Ausduck" ist so vieles, auf so verschiedene Weise, eine Grimasse ebenso wie ein Karl-Marx-Denkmal, eine Bewegung ebenso wie eine Forulierung, so daß "Geldausdruck" die Katgorie "Preis" nicht konkretisiert, nicht faßbarer macht. Bei einem "Namen" wird jemand gerufen, Herrscher oder Lakai, Ehefrau oder Hund, mit einem Namen stellt sich jemand vor. Der Name kann zutreffen oder nicht, kann eine rühmens- oder fluchwürdige Tradition aufrufen... Die Assziationen auf "Name" sind also eher noch weitgehender als die auf "Ausdruck", nur eben ungleich konkreter; sie beleben die Wortschöpfung "GELD-NAME", deuten mit jeder Assoziation ein Schicksal des Preises an. Zugleich gibt der Gegensat von Umgangs- und Wissenschaftssprache ("Geldname" - "vergegenständlichtes Quantum gesellschaftlicher Arbeit" eine Ahnung davon ab, daß der sichtbar gewordene "Preis" ein Eisberg ist: zu sechs Siebtel ist er auch noch nach der Definition im Meer der kapitalistischen Warenproduktion verborgen. Der wissenschaftlichen Analyse des Produktionsprozesses arbeitet auch Marx' plebejisch-materialistische Sicht der der Geschichte und der Kultur zu. Dem Marx folgenden Leser erscheinen die sezierten Verhältnisse "so einfach unddurchsichtig, daß selbst Herr M. Wirth sie ohne besondere Geistesanstrengung verstehen dürfte." 4 Wissenschaftliche Verständigung kommt ber die alltägliche in Gang: "Diese ursprünglice Akkumulation spielt in der politischen Ökonomie ungefähr dieselbe Rolle wie der Sündenfall in der Theologie." Ja, der gesunde Menschenverstand reicht völlig aus, krankhaft apologetische Theoriebildugn zu verlachen: "Adam biß in den Apfel, und damit kam über das Menschengeschlecht die Sünde. Ihr Ursprung wird erklärt, indem er als Anekdote der Vergangenheit erzählt wird. In einer längst verflossenen Zeit gab es auf der einen Seite eine fleißige, intelligente und vor allem sparsame Elite undauf den anderen faulenzende, ihr alles und mehr verjubelnde Lumpen. (...) Solche fade Kinderei kaut Herr Thiers z.B. noch mit staatsfeierlichem Ernst, zur Verteidigung des propriété, den einst so geistreichen Franzosen vor." 5 Das Marxsche Verständnis der Ökonomie setzt die Vertrautheit mit der Geschichte voraus: die Ware sei "geborner Leveller und Zyniker". Mit der Kultur: "In ihrer Verlegenheit denken unsre Warenbesitzer wie Faust. Im Anfang war die Tat. Sie haben daher schon gehamndelt, bevor sie gedacht haben." 6 In der strikten wissenschaftlichen Beweisführung, die dem "Kapital" Zeitlosigkeit gibt, ist die Sprache natürlich und bewußt ganz der Zeit ihrer Niederschrift verpflichtet, zum Beispiel in der Nutzung geläufiger Vorurteile: "DerKapitalist weiß, daß alle Waren., wie lupig sie aussehen oder wie schlecht iimmer rieche, im Glauben und in der Wahrheit Geld, innerlich beschnittene Juden sind und zudem wundertätige Mittel, um aus Geld mehr Geld zu machen." 7 Eben diese Wirkungen sind weder in Lehrbüchern noch in Einführungen intendiert, und sie sind also auch nicht aufzufinden, und die "Quelle" läßt auf den Grund sehen: Marx gibt auch im wissenschatlichen Hauptwerk nicht auf, die Melodie der versteinerten Verhältnisse in allen Stimmlagen und Instrumentierungen zu spielen. Die politische und welthistorische Asicht, das Kapital "zum Tanzen" zu bringen, realisiert er nicht nur nicht zletzt, sondern ganz hervorragend dadurch, daß er "Das Kapital" nicht als eine Antio-Versteinerung konzipiere und ausführte. So ist die Melodie des "Kapital" weder Agitationslied (was nach der Anekdote die preußische Zensur verblüfft haben soll) noch belehrender antiker Chor. Es ist der Gassenhauer des Schusterjungen, der den Kaiser nackt gesehen hat, das "Hahaha-Haah"-Lachen des Beethovenschen Gärtners als Motiv einer neuen Schicksalssinfonie. Jeder gedanke bekundet, daß er "ohne seine Hörer nichts ist / Weder gekommen wäre noch wüßte / Wohin gehen oder wo bleiben / Wenn sie ihn nicht aufnehmen." So mögen "acht Schuh tief" nicht besonders tief im "Kapital" sein, doch für diese wesentliche Einsicht und die folgende genügen: Jeder Gedanke in den Werken der Klassiker "von ihnen nicht belehrt / Den gestern noch Unwissenden / Verlöre (...) schell seine Kraft und verkäme eilig." 8 2 Wörterbuch der Ökonomie des Sozialismus. Berlin 1973, S. 708 f. 3 Marx, K.: Das Kapital. Kritikder politischen Ökonomie. Erster Band. In MEW, Bd. 23,Berlin 1977, S. 121. 8 Brecht, B.: Der Gedanke in den Werken der Klassiker. In: Gedichte, Bd. V, Berlin und Weimar 1978, S. 78.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||