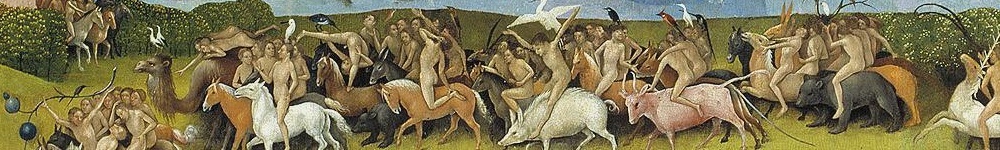 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
"Im Ernst, die Erde ist rund und dreht sich." IIIIm Bemühen, den Marxismus-Leninismus zum "Alltagsverstand eines Milieus" zu machen, müssen Marxisten nicht zuletzt lernen, ihr Weltanschauung - neben und gerade mit ihren Lehrsätzen und Methoden - als ein Zeichensystem, als eine Kulturform zu verstehen. So ergab sich der bereits hervorgehobene Stil des "Kommunistischen Manifests" aus der bewußten Verwerfung der Katechismus-Form, die didaktisch vielleicht zweckmäßiger gewesen wäre, aber auch jene sektiererische Theorie und Organisation bezeichnet hätte, an deren Überwindung Marx und Engels gelegen war. 1 Die "rote Fahne der Arbeiterbewegung", ideologisch mit dem Blut der Gefallenen, historisch mit dem Votum des Pariser Proletariats in der Revolution von 1848 zu erklären, beschwört zugleich auch die psychische Wirkung der roten Farbe überhaupt und nutzt die seit alters her geübte sakrale und zeremonielle Verwendung roter Elemente. Unbelastet ist nicht einmal die Form einer Parteiversammlung - Thema eines Gedichtes von Ludwig Fels:
"Immer hat der Vorsitzende das erste Zum anderen ist das bemühen, den Marxismus zum "Alltagsverstand eines Milieus" zu machen, immer eine konkrete Bemühung konkreter Personen und Bewegungen in konkretem Milieu, in geographischem, historischem und kulturellem Milieu. 1975, im UNO-Jahr der Frau, wurde der Lebens- und Kampfbericht von Domitila Barrios de Chungara weltweit bekannt - der Frau eines Mineros aus den bolivianischen Anden, Mutter von sieben Kindern, Sprecherin des solidarischen "Komitees der Hausfauen" der Bergwerkssiedlung Siglo XX: "Wenn man mir erlaubt zu sprechen" Domitila Barrios konnte aus den Erfahrungen in ihrer Hochgebirgs-Welt nur die vielfältigen gewerkschaftlichen Aktionen als hilfreich und nützlich schildern; mit Sympathie erinnerte sie sich jener Dissidenten der Kommunistischen Partei, die sich der Guerilla Che Guevaras angeschlossen hatten, und sie bestritt allen Parteien der bolivianischen Linken, "wirkliche Organisationen des Volkes" zu sein. Welchen praktischen Sinn könnte haben, dieser einfachen Frau als einer Anarchosyndikalistin, Ultralinken oder Trotzkistin das Wort zu verbieten, bei der ersten Lektüre marxistischer Schriften sei ihr ewesen, "als ob jemand meine Kinderträume gesammelt und in einem Buch niedergeschrieben hätte"? 3 Zu den konkreten Schicksalen der marxistischen Weltanschauung gehörte, wie sich Carlos Fonseca erinnerte, die Unschlüssigkeit der Frente Sandinista mit dem Marxismus-Leninismus eine Ideologie anzunehmen, die sich auf nationaler Ebene kompromittiert hatte" - durch taktischen Abstand vom Volkskampf. 4 Und schließlich können solche praktischen Erfahrungen, konkrete Entwicklungen und die massive antikommunistische Propaganda der oligarchischen Herrschaft zu einer Situation führen, wie sie Fidel Castro ironisch referierte: "Wir fragten manchmal aus Neugier verschiedene Menschen, darunter auch arbeiter: 'Seid ihr mit dem Gesetz über die Agrarreform einverstanden? Seid ihr mit dem Gesetz über die Wohnungsmiete einverstanden? Seid ihr mit der nationalisierung der Banken einverstanden?' Wir erhielten zur Antwort: 'Doch wir sind einverstanden.' 'Meint ihr nicht, daß all die Bergwerke dem kubanischen Volk gehören müssen, nicht aber einigen ausländischen Gesellschaften, nicht irgendwelchen Leuten, die in New York leben?' 'Doch.' So fand jedes einzelne dieser revolutionären Gesetze, fanden sie alle zusammen Zustimmung. Und dann fragten wir: 'Seid ihr mit dem Sozialismus einverstanden?' 'Nein, nein, nein! In keiner Weise!' Es ist unglaublich, was damals in den Köpfen der Menschen vor sich ging... Das ging so weit, daß ein Mensch mit dem Wesen all dessen, was dieses Wort enthält, einverstanden war, aber dem Wort selbst eben nicht zustimmen konnte." 5 So umständlich greifen Ideen nach den Massen und umgekehrt. 2 Fels, L.: Ich bau aus der Schreibmaschine eine Axt. Berlin und Weimar 1980, S. 141. 3 Vgl.: Viezzer, M.: Wenn man mir erlaubt zu sprechen. Zeignis der Domitila, einer Frau aus den Minen Boliviens. Berlin 1983, S. 188 - 198. 4 Fonseca, C.: Nikaragua - Stunde Null. In: Nikaragua - Dokumente einer Revolution. Leipzig 1985, S. 93. 5 zitiert nach: Lawrezki, J.: Ernesto Che Guevara. Berlin 1974, S. 231/232.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||